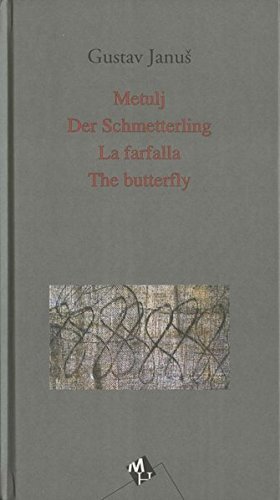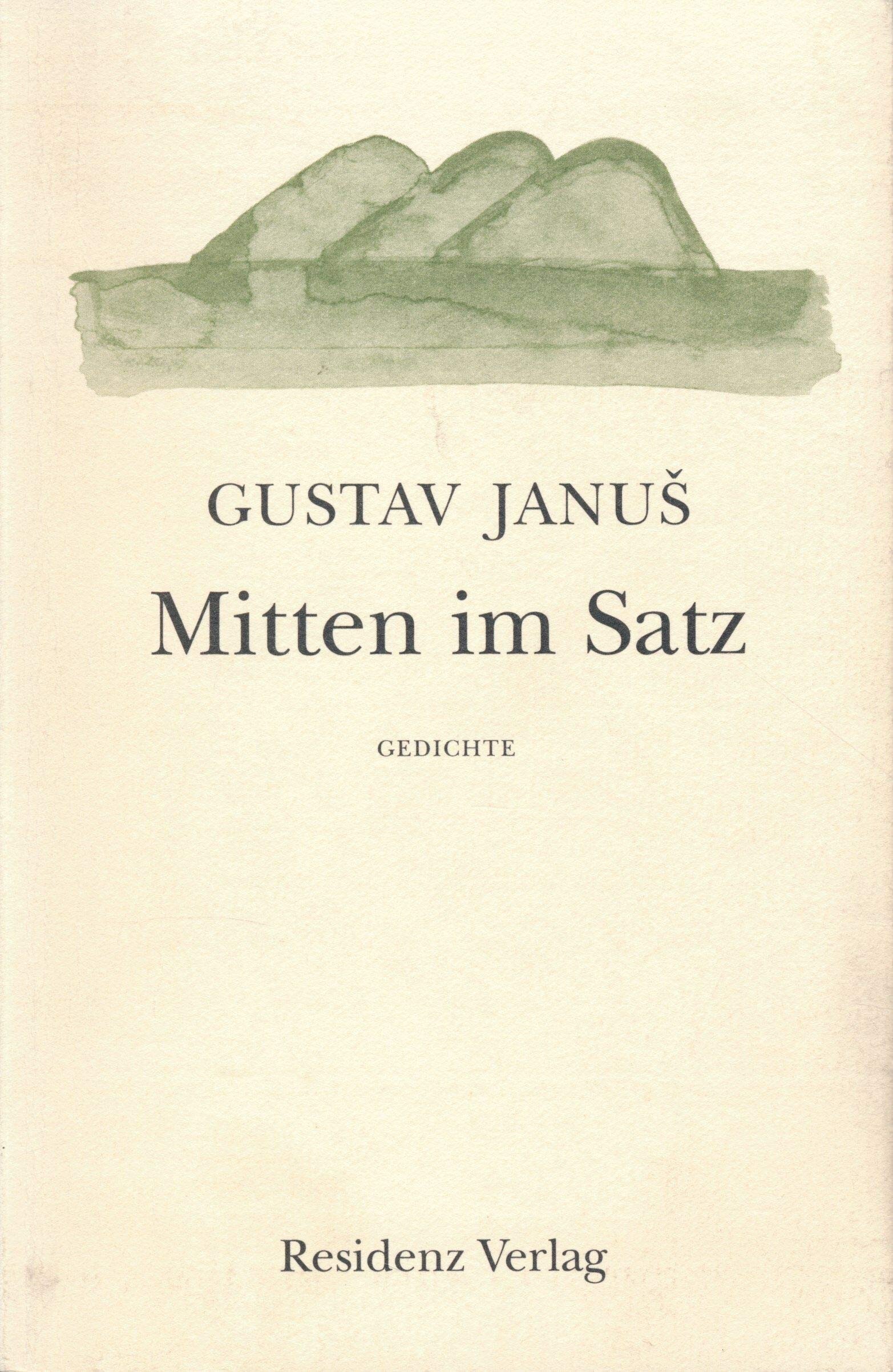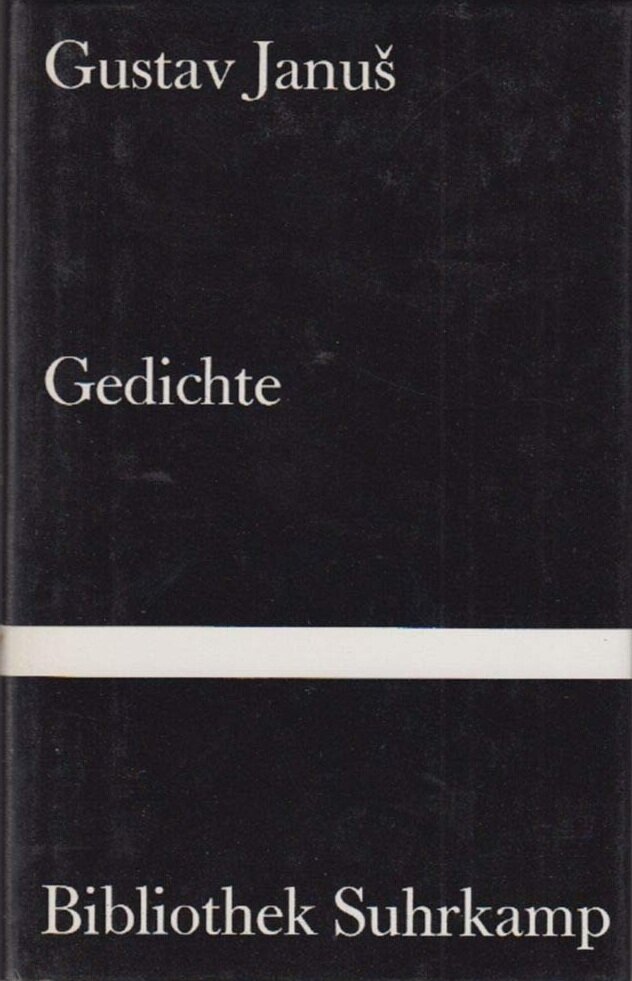Gustav Januš
Petrarca Preis, 1984
wurde 1939 geboren und ist ein österreichischer Maler, Dichter und Übersetzer, der ausschließlich slowenisch schreibt.
Ausgewählte Publikationen
Ausgewählte Videobeiträge
Peter Handke
Gegenreden und Rühmen
Lieber würde ich die Maultrommel schlagen oder die Mundharmonika blasen, als über Literatur reden. Und lieber würde ich über Literatur reden, als über das gegenwärtige Geschäft, den gegenwärtigen Umgang, den gegenwärtigen Handel mit der Literatur. Aber gerade von dem Letzteren muß aus Anlaß der Verleihung des Petrarca-Preises 1984 an den österreichischen Dichter slowenischer Sprache, Gustav Januš, auch einmal die Rede sein. Ich schwinge mich also auf und beginne meine Ehrung des Poeten - denn diese soll bei allem doch die Hauptsache sein - mit einer kurzen Beschreibung meiner Sicht der gegenwärtigen deutschen Literaturszenerie.
Ich sehe dort, wo einmal vielleicht Leidenschaft, Liebe, Erschütterung, Ernst, Zorn und heiterer, genauer Streit spielten, ein finsteres, jämmerliches, schamloses, beschämendes Geschiebe, Gedränge und Gerempel von Machthaberei, Schlagworten in jedem Sinn, Begrifferücken, Spiegelfechterei, Spitzfindelei - miteinem Wort: den so totalen wie totalitären Vordergrund, welcher nicht einmal beklagenswert ist, bloß zu verachten. Die Verachtung freilich sträubt sich gegen den Ausdruck, drängt zum Verschweigen und will doch nicht tatenlos bleiben: das ist ihr und das ist mein Problem. So sind die nun folgenden Worte ein Tatversuch.
Ich habe gerade das Wort »totalitär« gebraucht. Zuvor erschien einmal auch das Wort »spielen«: es hätten vielleicht einmal im Reden über Literatur Leidenschaft, Liebe undsoweiter gespielt. Eine der Gewohnheiten nun des heutigen Feuilletons ist es, die unterdrückten, verfolgten, zum Schweigen gezwungenen Künstler in den totalitären Staaten jenen in den sogenannten freien Ländern gegenüberzustellen. Um kein Spielen handelt es sich da, Vielmehr um ein bloßes Ausspielen. In der sogenannt freien Welt geht es, jedenfalls was die Literatur betrifft, auch totalitärz wenngleich auf eine andere Weise als in der augenfälligen Kerkerwelt. Die Verfolgung, die Unterdrückung, die Korrumpierung, das Mundtotmachen, das Totmachen von Schriftstellern geschieht hier - ich kann nicht sagen: »bei uns«- nur heuchlerischer, heimtückischer, gauklerischer und, wenn sich das Wort steigern ließe: faustrechthafter. Fast tagtäglich nimmt es sich in der Zeitung, welche sich so viel darauf einbildet, der Literatur einen besonderen Raum zu geben, ein junger oder alter Wicht, der weder ein so schönes Wort wie jung oder »alt«je verdienen wird, heraus, mit ein paar vollkommen vordergründigen, Satz für Satz durchschau- und vorhersehbaren Standardkniffen ein Buch, wie es auch sei, in ein Nicht-Buch zu zerkrümeln, vergleichbar mit einem Kerl, der, ohne zu wissen, was er tut, ein Stück Brot zerkrümelt, bis es nicht mehr Brot ist, und dafür auch noch bezahlt und dafür vielleicht auch noch in seiner Abendkneipe belobigt wird: »Den hast du aber prachtvoll fertiggemacht!« »Ein angerissenes Streichholz genügt, den Strand anzuzünden, an welchem gerade ein Buch umkam«, steht bei dem gewaltigen französischen Dichter René Char (den ich damit von Herzen und voll Zuneigung grüße). Hört auf, von der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten zu reden - ihr tut das gleiche immer noch, auf eure Weise, unauffälliger, aber genauso vorsätzlich, und kommt dazu straflos davon. Der sogenannte »Raum«, denjene Zeitung »für Deutschland« angeblich den Büchern gibt, ist das Gegenteil von einem Raum: Er ist ein stickiges, luftloses Henkerstübchen, vollgepfercht mit bieder-wahnsinnigen Unholden und ihren ehrsüchtigen, selbstversessenen Mietlingen. Kritiker zu sein, könnte ein guter, lehrreicher, Vergnügen bescherender Beruf sein; eine genaue, erzählende, aufschluss selnde und wiederum verschlüsselnde Besprechung eines Buches, ob mit Liebe oder mit Zorn verfaßt, zu lesen, hat mir schon oft Freude gemacht, oft das Hirn zum Glühen gebracht, ja michs gar gerührt und begeistert. Aber es gibt schon lange kaum Kritike mehr - nur noch gutbezahlte Angestellte, die sich aufspielen immer für sich selber, und immer gegen jemand andern; und die hellen Streitspiele sind zum bloßen Gegeneinander-Ausspielen verkümmert. Lest, Leute, daraufhin in dem besagten Machtblatt eine sogenannte Buchkritik: in fast jedem Fall wird da weder ein Buch sichtbar, noch wird eine Besprechung zur Lehre, sondern, Satz um Satz, das Ausspielen, dieses gegen jenen, jenes gegen diesen, zum Skandal: der totale, totalitäre Vordergrund. Würde das Wünschen helfen, so wäre folgendes mein Wunsch: eine Wiederholung, eine Erneuerung, eine Wiederbelebung der Haltung Walter Benjamins.
Stattdessen wird, vorgeblich als ein Ereignis literarischer Rührigkeit, schon seit geraumer Zeit einmal im Jahr in einer südlichen Stadt meines Heimatlandes Österreich das minderwertigste, schändlichste, menschenunwürdigste Spektakel abgehalten, das es, im Namen der Kultur, seit je gegeben hat; im Namen und unter dem Zeichen der Kultur betreibt in Klagenfurt, jener Stadt, wo in allen Straßen, auf allen Plätzen, unter jedem Baum, immer noch und für immer die unschuldig-wissenden Augen der herrlichen Ingeborg Bachmann aufgeschlagen sind, alljährlich, eingeladen und bezahlt von jener Behörde, bei der einst meine Mutter sich Füße und Seele wundlaufen mußte, um sich von Amtszimmer zu Amtszimmer ein kleines Darlehen für den Bau der dringendst nötigen Wohnung zu erbetteln, ein Trupp gravitätisch-nichtsnutziger Barbaren, vor denen ein paar arme, eifrige, beflissene Talente erzittern wie damals die gesamte Kärntner Bevölkerung vor den schrecklichen Türken, statt der Kulturerneuerung, -wiederholung, -weiterführung vielmehr einen finsterlich-grausig-legalisierten Akt der Kultur-Abtreibung. Die so oft nostalgisch heraufbeschworene, selige Gruppe 47 schon war vielmehr ein unseliges Übel, in dem die Literatur beschnitten wurde zu einem Flachding aus Meinung, Trend, Jargon und Sprachpolizei; für immer wird unverzeihlich bleiben, daß der große deutsche Epiker Hermann Lenz - für mich der größte nach Thomas Mann- und der große deutsche Lyriker Ernst Meister - für mich ebenbürtig der Ingeborg Bachmann und dem Paul Celanvon den Ausschließungs- oder Einlaßverwehrungsriten jener sitzriesigen Kleinbürger, aus denen sich die Gruppe vor allem rekrutierte, um das Gelesenwerden, um jede Antwort, um ihr Recht betrogen worden sind. Und betrogen worden sind auch wir, die Leser. Dafür wird es nie eine Lossprechung geben.
Aber der Wettbewerb, der die Unstirn hat, sich mit dem Namen einer unvergeßbaren Frau zu schmücken, ist etwas noch unvergleichlich Frevlerisches. Ein Wettbewerb der Körper kann etwas sehr Schönes sein - ein Weitsprung, der dem nächsten folgt, wobei auch der Zuschauer in sich den Weitsprung erlebt. Ein Wettbewerb der Rede schon ist fragwürdiger, angewiesen auf Suggestion, immer behaftet mit dem Makel des Nachgeschmacks. Ein Wettbewerb des Geistes, der Poesie, der Form jedoch ist niedrig und erniedrigend, sofern er nicht, wie im antiken Griechenland, vom Volk selbst entschieden wird: da hätte auch ich Lust, teilzunehmen und mit der Sprache meinen Weitsprung zu zeigen, mich zu freuen am Sieg, und mich zufrieden geben damit der Besiegte zu sein. Wo aber ist bei dem erwähnten Wettbewerb das Volk? Gibt es heutzutage ein für dergleichen Dinge waches, zuständiges Volk? Der Trupp der aus ihren Kümmerlöchern herbeigereisten Feder- und Mikrophonfuchser jedenfalls, nach ihren Floskeln, Spruchtafeln und geheucheltem Ernst zu schließen, ist nur noch die Verhöhnung jener Volk-Idee: und ihre weinenden oder glückstrahlenden Opfer werden danach zwar immer weiterschreiben, aber alles, was sie schreiben werden, wird gezeichnet sein von dem unrechten, unzulässigen Wettbewerbsverhalten. Sie werden immer nur Talente bleiben. Ein Spruch, von einem der selbsternannten Kunstschöffen selber verbrochen, verdeutlicht vielleicht die ganze Szenerie: »Einmal im Jahr ist Klagenfurt die Hauptstadt der Literatur.«Und das ist die Literatur heute?
Zum Bild nicht zum Inbild, sondern zum Punkt-und Zerrbild - ist mir der Stand unserer westlichen Kultur»betrachtung« einmal, vor Jahren, in New York geworden, als ich in einer Menschenschlange vor einem Kino wartete: Alle meine Vordermänner und -frauen hatten die gefaltete Zeitung mit dem Kinoteil unter dem Arm, und genau an den Falten waren untereinander die Sterne gereiht, mit denen die Kritiker die laufenden Filme von Manhattan bedacht hatten; der Film, auf den wir alle warteten, hatte dreien halb Sterne. Dazu passen die Annoncen wie: »Dieses Buch wurde von siebenunddreißig namhaften deutschen Kritikern auf die erste Stelle der Bestenliste des Südwest- oder Nordostfunks gesetzt«. Sogar mein lieber eigener Verlag ziert ein ausländisches Buch schon mit der Schleife: »Wurde von fünfzehn bedeutenden schwedischen Kritikern zum Buch des Jahres gewählt«. (Ich habe von diesem Buch nicht einmal die Plastikstrumpfhose, die jetzt alle Bücher verschweißt, entfernt.) Ebenso hörte ich in einem Gespräch mit einem eigentlich verständigen, offenen, lesenden Menschen eine seltsame Platzanweisung für die gegenwärtige Literatur der verschiedenen Erdländer: An erster Stelle stünde die südamerikanische Literatur, dann folge aber schon die deutsche; worauf ich fragte, welches Land nun an der dritten Stelle läge, worauf wir wenigstens lachten. Es gibt keine Weltliteratur mehr.
Damit bin ich nun, endlich, beim Übergang zu dem österreichischen slowenischen Dichter Gustav Januš und zu dem PetrarcaPreis, den wir in diesem Jahr zum letztem Male verleihen. Es ist der Hauptpunkt, aber ich werde mich kurz halten. In unserem Jahrzehntläuft ja auch eine beliebte Klagereium-Klagereiverhält sich zu Klage wie Liebelei zu Liebe -, es gebe keine epochale, bedeutende, welthaltige (und wie die Halbwörter alle heißen) Literatur mehr. Ich bin in der schönen, manchmal anstrengenden Lage, viel von dem zu lesen, was heutzutage geschrieben wird; es wird mir auch, von ganz Unbekannten, Manuskript um Manuskript geschickt, und ich bemühe mich, nicht nur darin zu blättern, und immer wieder habe ich dabei die starke Empfindung, daß das Formen, das Fassenwollen, kurz, das Schreiben in der Menschheit blüht wie je, oder: kurz vor der Blüte steht - wie je. Oft ist mir bei meiner eigenen Arbeit ein Mann aus der Bibel in den Sinn gekommen, den ich mir dann als den Patron für uns Schriftsteller, oder überhaupt für die Künstler, dachte. Man mögeruhig darüber lachen: es ist Johannes der Täufer. So wie er meinte, nach ihm käme der Größere, so empfinde auch ich immer, es nicht zu schaffen, doch einer, oder nicht bloß einer, würde auftreten, nicht nach mir, sondern vielleicht schonietzt, und schreibend sagen, was der Fall ist: ein-facher, dringlicher, erlösend. Und diese Empfindung schmerzt mich keinen Augenblick lang; sie tröstet mich.
Wie bin ich überhaupt auf die österreichische slowenische Lite ratur gekommen, welche an der südlichen Grenze des deutschen Sprachraumes, in Südkärnten, ein eigenes Sprachland bildet? Ich stamme selber aus dem ländlichen Südkärnten, und meine Mutter wie meine Großeltern waren Slowenen, wie Gustav Januš ein Slowene ist. Es sind nur unsere Täler verschieden: er kommt aus dem Rosental, ich komme aus dem Jauntal. Ich habe in der Schule ungern, weil gezwungen, die slowenische Sprache gelernt und bald wieder vergessen. Die slowenischen Gottesdienste in der Heimatkirche waren, durch ihre Inbrunst, ihren musikalischen Atem und ihr heiteres Gepränge, die einzigen bisher, bei denen ich einen Begriff von dem Wort »Gottesdienst« bekam; die Litaneien waren kein Geleier, sondern wirkliche, begeisterte wie trauervolle Anrufe. Vor einem Jahrfünft, nach Österreich zurückgekehrt, war ich entschlossen die slowenische Sprache neu zu lernen, und ich wollte das nicht mit dem Gerüst der Grammatik tun, sondern mit Hilfe des Hauses der Literatur. Und als ich die ersten Sätze des Romans »Der Zögling Tjaž« des Kärntner slowenischen Epikers Florjan Lipušlas, war ich auch tatsächlich zuhause, so wie ich in der Literatur meines Heimatstaates noch keinmal zuhause gewesen war: »Dočakae si, da greš skozi vasi. Vse počitnice nisi hodil skozi tako na veliko, kot greš danes. - Endlich gehst du durchs Dorf. All die Ferientage bist du nicht so großartig hindurchgegangen wie heute.« - Und ähnlich erging es mir, als ich mich, viel später, und eher zuerst im Spiel, an einer Übersetzung der Gedichte von Gustav Januš versuchte:
»Skozi okna
hišma vrata
sem stopil v sobo,
prižgal luč
insedel ma klop.
Bil sem sam...«
»Durch die enge
Haustür
bin ich ins Zimmer getreten,
habe das Licht eingeschaltet,
und mich auf die Bank gesetzt.
Bin allein gewesen.
Der Stuhl,
manchmal Platz der Mutter,
ist leer gewesen.
Ich habe ihn zum Zimmer hinaus getragen,
im Bewußtsein,
daß es für die Mutter
kein Heimkommen mehr geben wird,
weil sie im Vorjahr gestorben ist
und jetzt draußen liegt,
auf dem Friedhof.
Und dann, nach diesem Gedicht, das der Zwanzigjährige schrieb, ein Gedicht des Fünfundvierzigjährigen:
»Kakor večno domotožje
privre iz spomina
prilika o izgubljeni sin...«
»Wie ein immerwährendes Heimweh
entströmt dem Gedächtnis
das Gleichnis vom verlorenen Sohn...«
Was ist es, das mich, über jeden Lebensgrund hinaus, eine solche Zuneigung hat fassen lassen zu dieser slowenischen Sprache? Ich weiß ja, daß jede Sprache schön ist, auch jene, die der sogenannte Volksmund (das Wort sollte es nur noch als Schimpfwort geben) verspottet. Aus dem Slowenischen höre ich jedoch noch einen Zusatz zu all dem Schönen und Lieblichen jeder Sprache heraus. Vielleicht ist es die Fülle der dinglichen Wörter, das heißt, der Wörter, die zugleich die Melodie, die Farbe, die Form, die Fruchtigkeit des jeweiligen Dinges wiedergeben. Und es handelt sich immer um die sogenannt kleinen, die ländlichen, die natürlichen Dinge, auch der Menschennatur. Ich nenne ein paar Beispiele. Im letzten Zitat steht das Wort »domotožje«; es bedeutet »Heimweh«. Dieses »domotožje« nun ist zusammengefügt aus den Wörtern »dom« (Haus, Heim) und »tožba« (die Klage). Das Wort für »Trauer« ist »žalost«. Das Wort für »Freude« ist »radost«. Das Wort für »Sehnsucht« ist »hrepenenje«. Das Wort für »Leben«, sehr häufig bei Gustav Januš, ist »življenje«. Das Dingwort für Apfel« ist »jaboeko«, das für die Maulbeere »murva«, das für die Himbeere »malina«. Dabei darf nicht verschwiegen werden, daß die slowenische Sprache, was die Begriffe, Abstraktionen, amtliche Wörter betrifft, im Gegensatz zu den gerade erwähnten von einer häßlichen, fast absurden Künstlichkeit ist: die Amtswörter sind nämlich jeweils wörtliche Entsprechungen zum Deutschen; es hat sie im Slowenischen nie gegeben, denn die Slowenen waren immer nur ein Volk »Volksgruppe« nennen die österreichischen Behörden das widersinnig, und wir anderen plappern es nach - als ob »Volk« und »Gruppe« je zueinander kommen könnten) - sie waren nur ein Volk und nie ein Staat.
Was finde ich in den Gedichten des Gustav Januš, über die Dingwörter hinaus? Es ist vielleicht das Absichtslose, Willen-lose; das Eigen-Mächtige. Die herrschende Literatur unseres Jahrhunderts besteht fast nur aus Leuten, welche von der Welt, dem Dasein, der menschlichen Existenz eine Meinung haben. Die Stärksten dieser Schriftsteller haben eine starke, gewissenhafte, sinnenhafte Meinung, aber es bleibt doch eine Meinung. Franz Kafkas beliebtes Gib's aufl« ist nichts als Meinung. Samuel Bekketts Spruch vom Geborenwerden über dem offenen Grab, über dem wir kurz erglänzen, ist nichts als Meinung. Ciorans Leier vom Unglück, geboren zu sein, ist nichts als (schon schlechtere) Meinung. Sogar Rilkes wunderbarer Vers vom Schönen, das nur des Schrecklichen Anfang sei, wird leider mißbraucht als Meinung; so wie ich auch nicht einverstanden sein kann mit der Bemerkung meines geliebten Walker Percy aus dem »Kinogeher«: »Die Schönheit ist ein Biest.« Da überwältigt und überzeugt mich doch weit mehr die kleine Bemerkung eines Kindes im Gedränge eines großen Bahnhofs, wo Erwachsener und Kind unversehens des Schnees auf dem Bahnhofsglasdache gewahr wurden und das Kind, auf den Ausruf des Erwachsenen: »Wie schön!« sagte: »Das Schöne sieht man so schlecht«
Ja, das Schöne sieht man schlecht; aber Gustav Januš ist ihm in all seinen Gedichten auf der Spur. Es gibt kein Gedicht von ihm, das etwas behauptet oder meint. Seine Poeme sind, so könnte man sagen - und das ist es auch, was das Poetische an ihnen ausmacht -, das reine Hin und Her. (Gustav Januš hat im übrigen, soviel ich weiß, noch nie eine einzige Prosazeile geschrieben.) Das reine Hin und Her: die Schwebe, der Widerstreit, das Dialektische (Verzeihung für dieses Wort). Insofern beschreiben seine Gedichte nicht nur Augenblicke, so wie es die japanischen haikustun (mit denen Januš' Sprache trotzdem viel gemein hat), sondern ganze Tagesläufe: Das Hin und Her der langen Tage Reise in die Nacht, und zur Nacht hinaus. Und indem jedes Gedicht ein Tageslauf ist, zeigen die Gedichte zusammen einen Lebenslauf; nein, nicht nur einen, sondern viele Lebensläufe, oder einfach nur seinen, meinen und deinen. Wir nennen Gustav Januš einen Dichter, weil er an keiner Stelle meint, sondern stetig sachlich sagt. Was einer allein denkt, ist bloße Meinung“, sagte Parmenides. Gustav Januš denkt, schreibend, nicht allein.
Heimischer Acker
Die Glocke hat in mir
die Erinnerung geweckt
an den heimischen Acker, wo
mich der Vater hingeführt hat,
die Sonne anzuschauen,
an den Acker, wo
er mir nahegebracht hat,
daß dieser Früchte trägt
und den Bedürftigen
Nahrung gibt. Er hat mir gesagt, ich
sollte ihm zugeneigt sein,
so wie die Erde
ihren Lebensformen
zugeneigt ist.
Ich bin befremdet gewesen.
War noch ein Kind.
Und nun bin ich zurück bei den Gedichten, der Maultrommel, der Mundharmonika. Ein Vers in einem kleinen Gedicht von Nicolas Born lautet: »Summt, kleine Liedchen, summt.«